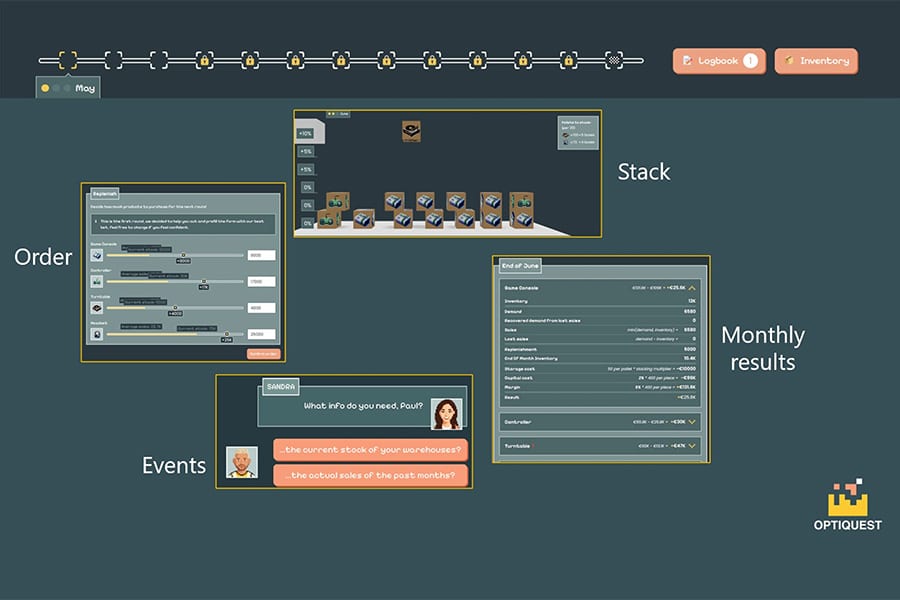Ist ein BREEAM-Zertifikat (noch) sinnvoll?
Im Zuge der Entwicklung hin zu nachhaltigeren Logistikimmobilien hat sich das BREEAM-Zertifikat als Label etabliert, mit dem man die Nachhaltigkeit eines Lagers auf einen Blick beurteilen kann. Für den Bauherrn und/oder Eigentümer eines solchen zertifizierten Standorts ist die Erlangung des Gütesiegels jedoch mit einem hohen Kosten- und Ressourcenaufwand verbunden. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist nicht jedes Unternehmen bereit, diese zusätzlichen Anstrengungen zu unternehmen. Allerdings haben die Kunden nicht mehr immer die Wahl.
Die BREEAM-Methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) gilt seit ihrer Einführung in den 1990er Jahren als das "Nachhaltigkeitsdiplom" der Wahl für Gebäude. Die vom britischen Building Research Establishment (BRE) entwickelte Methodik hat sich auch bei Logistikimmobilien etabliert. Die BREEAM-Methode bewertet die ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsleistung eines Projekts und berücksichtigt dabei den Einsatz von (erneuerbaren) Energien am Standort, den ökologischen Umgang mit Grund und Boden, die nachhaltige Verkehrsanbindung und die Abfallentsorgung. Auch die Licht- und Luftqualität im Gebäude, die für das Wohlbefinden der Mitarbeiter wichtig ist, wird berücksichtigt. Das Dutch Green Building Council überwacht die BREEAM-Zertifizierung in den Niederlanden. In Belgien wird hauptsächlich auf BREEAM Communities verwiesen, die Online-Datenbank, die Bauherren und Kunden über die Voraussetzungen für eine Zertifizierung (von "bestanden" bis "hervorragend") informieren soll.

Einheimische
Das BREEAM-Gütesiegel kann inzwischen als gut etabliert gelten, und seit einiger Zeit ist es üblich, dass in Berichten über die Realisierung neuer Logistikprojekte auch deren BREEAM-Ranking erwähnt wird. Es gibt jedoch auch Unternehmen, die bei ihren neuen Projekten nicht den Zertifizierungsprozess durchlaufen. Sie protzen nicht damit und werden es daher wahrscheinlich auch nicht öffentlich zugeben, aber nicht jedes Unternehmen, das ein neues (Logistik-)Gebäude bezieht, lässt es nach BREEAM zertifizieren.
Luc Ysebaert, kaufmännischer Direktor beim belgischen Industriebaukonzern Willy Naessens, sieht eine Situation der zwei Geschwindigkeiten. "Für Unternehmen, die sich an ein breites Spektrum internationaler Kunden wenden, ist eine Zertifizierung praktisch obligatorisch. Große multinationale Marken haben zum Beispiel große Ambitionen in Sachen Nachhaltigkeit, in die auch ihre (Logistik-)Subunternehmer einbezogen werden müssen. Wer mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten will, muss in der Lage sein, seine Nachhaltigkeitsbemühungen nachzuweisen.
Zusätzliche Kosten
Ysebaert zufolge haben etwa 3 von 10 Gebäuden, die Naessens in letzter Zeit gebaut hat, eine BREEAM-Zertifizierung. Die Tatsache, dass sich die meisten Kunden nicht für das Label entscheiden, hat seiner Meinung nach vor allem mit den zusätzlichen Kosten zu tun. "Rechnen Sie mit zusätzlichen Kosten von 300.000 bis 400.000 Euro für ein ganzes Projekt. Als Auftragnehmer haben Sie eine Menge Arbeit zu erledigen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Mitarbeiter pro Projekt fast Vollzeit mit der Zertifizierung beschäftigt ist. Dabei geht es übrigens nicht nur um die möglichen Kosten für nachhaltige Technik im Gebäude, wie Lüftung und Abwasserbehandlung. Auch die Baustelle muss plötzlich viel hochwertiger und komfortabler eingerichtet werden. Folge: Schon die Bauhütte für die Bauarbeiter wird dreimal so teuer wie normal."
Das Bauen ist also in den letzten Jahren sehr viel teurer geworden. Probleme in der Lieferkette von Baumaterialien, Energieschocks und Lohnkostensteigerungen führen dazu, dass die Bauherren auf die kleinen Dinge achten. "Bei einigen, einfacheren Projekten ist es einfach so, dass es keine oder kaum Komponenten im Gebäude gibt, für die BREEAM gelten könnte", sagt Ysebaert. "In anderen Fällen gehen die Kunden vielleicht davon aus, dass ein Zertifikat für sie keinen Mehrwert bringt. Das bedeutet übrigens nicht, dass sie sich nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Auf Dächern montierte Solarzellen zum Beispiel sind voll etabliert". Es sieht also eher so aus, als ob die Bauherren die Nachhaltigkeit ihrer neuen Gebäude nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und selbst entscheiden, wo das Gleichgewicht zwischen Umweltnutzen und zusätzlichen Kosten liegt, allerdings ohne die strengen Anforderungen des internationalen BREEAM-Standards.
Kein Entkommen?
In den nächsten Jahren wird das Thema Nachhaltigkeit jedoch immer weiter nach oben auf der wirtschaftlichen und politischen Agenda rücken. So verpflichtet die Einführung der europäischen Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) börsennotierte Unternehmen und öffentliche Versorgungsbetriebe bereits ab diesem Jahr dazu, ausführlich über ihre Nachhaltigkeitsziele zu berichten. In späteren Phasen werden auch kleinere Unternehmen an der Reihe sein. Große Verlader werden daher zunehmend kritisch auf die Bemühungen ihrer Logistik-Subunternehmer um eine nachhaltige und umweltfreundliche Arbeitsweise achten. Schon jetzt werden die großen Unternehmen für ihre so genannten Scope-3-Emissionen (dazu gehören die mit dem Transport und der Lagerung ihrer Produkte verbundenen CO2-Emissionen) zur Rechenschaft gezogen. Wer also als Logistiker mit ihnen zusammenarbeiten will, muss seine Nachhaltigkeitsbemühungen nachweisen können. Vielleicht sollte man dann doch ein BREEAM-Label in Betracht ziehen?