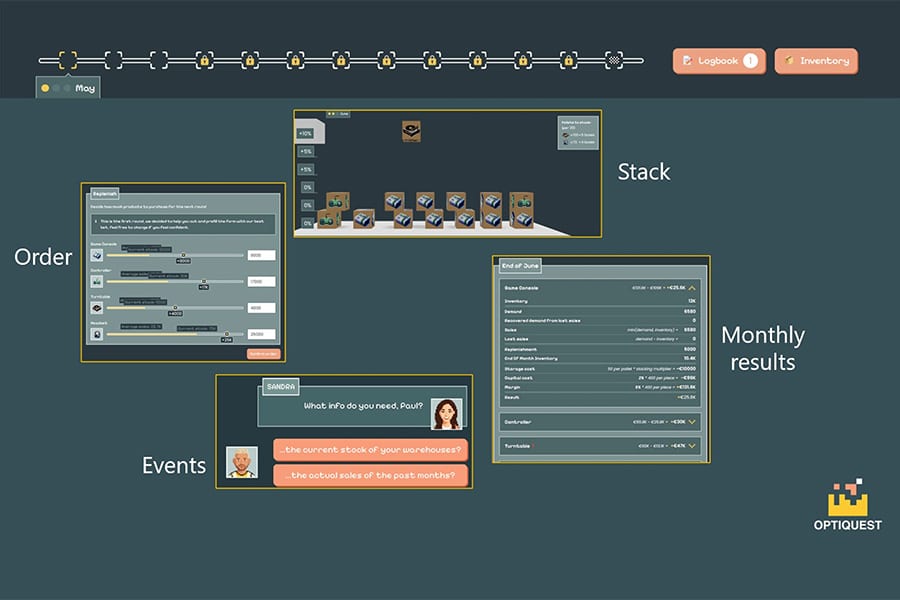The Pen | "Eine Nation, die lebt, baut ihre Zukunft auf
Das 10-jährige Bestehen dieses Fachmagazins ist eine gute Gelegenheit, einen Blick darauf zu werfen, wo die GWW-Branche anno 2019 steht. Das Weltwirtschaftsforum hat dazu eine klare Meinung. Diesem führenden Institut zufolge gehört unsere Infrastruktur in diesem Jahr zu den vier besten der Welt.
Wer unser Land mit den Augen eines Ausländers betrachtet, versteht diese Bewunderung. Die Niederlande sind eine wahre Freiluftausstellung von Ikonen des nachhaltigen Bauwesens. Im letzten Jahrzehnt sind auch schöne Beispiele dafür entstanden.
Nehmen wir zum Beispiel den Landtunnel der Autobahn A2 in Maastricht. Seit dieser Tunnel 2016 für den Verkehr freigegeben wurde, belastet der Durchgangsverkehr die Stadt nicht mehr. Die Wohngebiete, die jahrelang durch die A2 getrennt waren, wurden wieder miteinander verbunden. Auf dem 2,3 Kilometer langen Tunnel ist nun ein grüner Teppich ausgerollt worden, der neuen Raum für Erholung und Wohnen bietet.
Eine zweite Ikone ist für mich das Markerwadden. Im September 2018 wurde die erste Insel eines Archipels von Inseln eröffnet, die einen gesunden Lebensraum für Vögel, Fische und Wasserpflanzen bieten. Ein schönes Beispiel für die nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten und dem Bauunternehmen.
Ein drittes Symbol für nachhaltige Innovation ist meiner Meinung nach das Kreisviadukt bei Kampen. Wir haben dieses Viadukt im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Markt entwickelt, und jetzt wurde es erfolgreich zurückgebaut. Während gewöhnliche Viadukte nach 30 bis 50 Jahren abgerissen werden, ist die Lebensdauer dieses Kreisviadukts mit 200 Jahren etwa sechsmal so lang.

Luftaufnahme des Sturmflutwehrs an der Oosterschelde (Bild: Thomas Fasting)
Jedes dieser Beispiele zeigt, dass der Einsatz für eine gesunde, natürliche Umwelt inzwischen zu unserer Schlüsselkompetenz geworden ist. Dieses Wissen und diese Erfahrung sind in diesen Zeiten wertvoller denn je. Die Gesellschaft verändert sich immer schneller und radikaler. Denken Sie zum Beispiel an die Energiewende, das Bevölkerungswachstum, den Klimawandel, die Nachhaltigkeitsziele der Regierung und die wachsende Mobilität. All diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Gesundheit, die Umwelt und die Gestaltung des öffentlichen Raums.
Auch in den kommenden Jahrzehnten wird sich unser Land weiter verändern. Nicht nur, um Häuser zu bauen und Wind- und Solarparks zu errichten. Sondern auch viele zusätzliche Fahrspuren, um Verkehrsengpässe zu beseitigen. Was die Infrastruktur betrifft, so werden wir vor allem damit beschäftigt sein, das zu erhalten, was wir haben. Hunderte von Brücken, Viadukten, Schleusen und Dämmen müssen saniert oder ersetzt werden.
Das verspricht eine große, komplizierte Aufgabe zu werden. Wir werden überall arbeiten, und die Niederlande dürfen nicht steckenbleiben. Unsere Herausforderung besteht darin, die Unannehmlichkeiten für den Verkehr und die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Im Einklang mit dem Umweltgesetz, das 2010 in Kraft treten wird, werden wir die Bürger noch intensiver in jeden Eingriff in das Wohnumfeld einbeziehen.

Die Statue von Cornelis Lely. Die Bronzetafel unter dem Denkmal trägt das treffende Motto: "Ein Volk, das lebt, baut seine Zukunft". (Bild: Henri Comont)
Außerdem werden wir zunehmend klimaneutral und kreislauforientiert arbeiten müssen. Mit den Themen Stickstoff und Pfas haben wir ein enorm komplexes Puzzle zu lösen. Wir tun alles, was wir können, um die Niederlande in Bewegung zu halten, aber die Planung von Infrastrukturprojekten ist nicht einfacher geworden.
Wir stehen also vor einer herausfordernden Zukunft, in der nicht alles so gemacht werden kann, wie wir es gewohnt sind. Sind wir als Branche darauf vorbereitet? Diese Frage habe ich Ende 2018 dem Beratungsunternehmen McKinsey gestellt. Sie kam zu dem Schluss: "Wir können nur mit einem vitalen, gesunden, innovativen und nachhaltigen Markt erfolgreich sein. Das bedeutet sowohl für den Marktsektor als auch für Rijkswaterstaat etwas. Der Sektor muss produktiver werden und daran arbeiten, die Ausfallkosten zu senken und die Effizienz zu steigern.
Auch Rijkswaterstaat wird sich in seiner Rolle als Auftraggeber verändern müssen. Es ist an der Zeit, aus unserem Elfenbeinturm herabzusteigen. Wir müssen lernen, den Übergang von 'viel auf dem Papier zu den Füßen auf dem Boden' zu vollziehen. Rijkswaterstaat wird lernen müssen, Projekte besser zu verwalten und mehr Aufträge zu erteilen. Außerdem wollen wir in andere Verträge und in eine bessere Risikoverteilung bei Projekten investieren. Damit die Unternehmen, die für uns arbeiten, einen angemessenen Lohn für ihre Arbeit erhalten.
Außerdem können wir viel mehr von neuen Technologien, IKT und Daten profitieren. Zum Beispiel, um unser Land klimaresistenter zu machen. Aber auch, um unsere Infrastruktur intelligenter zu machen. Verjüngen, erneuern und nachhaltig machen" ist unser Credo. Selbst wenn wir eine Straße renovieren, können wir sie nachhaltiger machen und sie auf die Mobilitätsbedürfnisse der Zukunft vorbereiten.

Der Afsluitdijk wird zum Symbol für Verjüngung, Erneuerung und Nachhaltigkeit. (Bild: Ivo Vrancken)
Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir zusammenarbeiten. Wir werden zunehmend andere Branchen in unsere Arbeit einbeziehen und lernen müssen, in wechselnden Baugruppen zu arbeiten. Die GWW wird bei großen Projekten nicht mehr automatisch der Hauptauftragnehmer sein. Wenn es die Aufgabe erfordert, werden zunehmend IKT- oder Elektrounternehmen die Führung übernehmen.
Kurz gesagt, die künftigen Aufgaben erfordern einen Wandel im gesamten Bausektor. Dies gilt sowohl für die Rolle der Auftraggeber als auch für die der Auftragnehmer. In der Zwischenzeit arbeite ich gemeinsam mit dem Markt an einem Aktionsplan. Auf dieser Grundlage möchte ich mich zu einem vitalen Sektor entwickeln, der die Bau- und Instandhaltungsaufgaben in unserem Land gestalten kann.
So schwierig diese Aufgabe auch erscheinen mag: Ich weiß, dass sie machbar ist. In der Tat sehe ich in unserem Land bereits Ikonen, die von diesen nachhaltigen Innovationen und der innovativen Zusammenarbeit zeugen.
Ich denke, die Renovierung der IJssel-Brücken auf der A12 ist ein großartiges Beispiel für eine innovative Auftragsvergabe. Rijkswaterstaat wird den Sanierungsprozess in zwei Phasen unterteilen. Wir werden den Preis für die risikoreichsten Teile erst dann festlegen, wenn wir diese Risiken richtig einschätzen können. Wir werden auch mit so genannten Portfolioverträgen experimentieren. Diese bieten dem Sektor Chancen für Innovationen und die Möglichkeit, Investitionen über mehrere Projekte zu amortisieren.
Ich denke, die Renovierung der Wantijbrug zwischen Papendrecht und Dordrecht ist ein Paradebeispiel für den Einsatz von Daten und IT in unserer Arbeit. Diese Brücke wird die erste sein, in die der neue "3B Building Block" eingebaut wird. Der Baustein macht die Brücke intelligenter und effizienter im Betrieb, in der Verwaltung und im störungsfreien Betrieb. Mit dieser neuen Software und Hardware kann Rijkswaterstaat auch andere Tunnel, Schleusen und Brücken auf standardisierte Weise auf die Zukunft vorbereiten.

Brücke im Markerwadden. (Bild: Shutterstock)
Und schließlich komme ich zum Afsluitdijk. Bis 2022 bauen wir dieses 87 Jahre alte Symbol für Wassersicherheit zu einem sicheren, nachhaltigen und intelligenten Deich um. Der Deich wird das Symbol für Verjüngung, Erneuerung und Nachhaltigkeit sein. Mit einer neuen Verkleidung aus 75.000 riesigen Betonsteinen, mit neuen, leistungsfähigen Schleusen, mit einem nachhaltigen Fischwanderfluss und mit Techniken zur Energiegewinnung aus Meerwasser.
Eine Sache am neuen Afsluitdijk bleibt unverändert. Die Statue des großen Cornelis Lely wird bald dort stehen, wo der Deich einst geschlossen war. Die Bronzetafel unter dem Denkmal trägt den treffenden Spruch: "Ein Volk, das lebt, baut seine Zukunft".
Das ist für mich das Motto, das uns auch in diesen Zeiten antreibt. Unter unseren Händen werden die Niederlande in den kommenden Jahrzehnten umgestaltet werden. Indem wir gemeinsam an nachhaltigen Innovationen arbeiten, die wir behutsam in das Lebensumfeld unserer Kinder und Enkelkinder einbauen.
Ich wünsche dem Bauingenieurwesen eine nachhaltige, herausfordernde Zukunft!
Michèle Blom,
Generaldirektor für öffentliche Arbeiten.